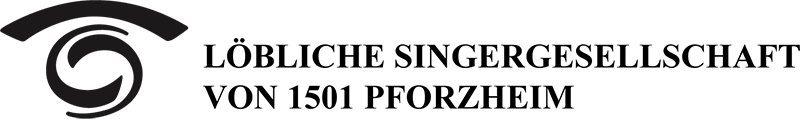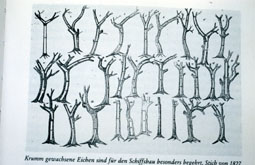Flößerei im Schwarzwald – Schiff-Fahrt auf den kleinsten Schwarzwaldbächen?
Vortrag
Gottfried Zurbrügg, Autor des Romans „Wellenreiter“
anlässlich der Matinee zur Stadtgeschichte am 18.07.2004
.
Sehr geehrte Damen und Herrn,
vor sich sehen Sie einen Flößer. Er ist deutlich erkennbar an seinem weißen Hemd, der Lederweste, dem breitkrempligen Hut und vor allem am Knotenstock und an der Wiede über der Schulter.
Sie sind nicht ganz einverstanden?
Ich gebe es ja zu: Die Stiefel fehlen!
Aber sonst ist alles echt.
Nein?
Ja, Sie haben gut beobachtet: die Sprache. So spricht kein Flößer. Zumindest nicht aus dem Schwarzwald. Ich lebe zwar schon seit über 30 Jahren im Schwarzwald, aber die Sprache meines Geburtsortes habe ich dann doch behalten. Ich bin zufällig in Bielefeld geboren. Zufällig, weil meine Mutter auf dem beschwerlichen Fußweg von Berlin nach Freiburg war. Aber auch in Norddeutschland gibt es Flößervereine und eine lange Tradition der Flößerei auf den großen Flüssen Norddeutschland: Der Weser, der Ems, der Elbe und wie die großen und kleinen Flüsse alle heißen. Es war viel einfacher auf den großen Flüssen Holz in Flößen zu transportieren, als auf den kleinen Schwarzwaldbächen, die nach der Schneeschmelze sehr reißend waren und im Sommer meist viel zu wenig Wasser hatten. Dazu gehörte eine besondere Technik, die sich nach und nach entwickelte, und die Schifffahrt auf den kleinsten Bächen möglich machte.
Ich bin also kein Flößer?
Nein, so kann man es auch nicht sagen.
Ich bin Schriftsteller oder am liebsten nenne ich mich einen Dichter. Ich bin ein Mensch, der den Schwarzwald mit dem Herzen sieht. Dem die Landschaft etwas sagt, mit dem der Wald redet, dem die Bäche etwas zumurmeln, dem die Gedenksteine und Feldkreuze am Wegrand Geschichten erzählen.
So haben sie mir auch die Geschichte der Flößerei erzählt. Es war nicht einfach, den Wald und die Steine zum Reden zu bringen. Viele Wanderungen waren nötig, viele Stunden der Betrachtung der wenigen Spuren, die sich heute noch im Walde befinden und auch viele Stunden des Bücherstudiums und des Stöberns in den Archiven, in denen die Heimatforscher vieles zusammengetragen haben. Ich habe die exakte Arbeit der Historiker bewundert und ihre Erkenntnisse verarbeitet. Damit konnte ich manches korrigieren, was mir die Bäche erzählten, denn Wind und Wellen nehmen es nicht so genau mit der Wahrheit. So haben wir zusammengearbeitet, die Historiker, der Schwarzwald mit seinen Bächen und ich. Daraus ist ein Buch geworden: Der Wellenreiter. Es erzählt die Geschichte von einem kleinen Schwarzwalddorf, denn irgendwo muss man den Faden der Geschichte aufnehmen. Auf einer Wanderung durch meinen Heimatort, Zell a.H., hatte ich plötzlich so einen Faden in der Hand, der mich nach Nordrach führte, denn dort begann für mich die Geschichte, die mich durch den ganzen Schwarzwald führte.
Das Bild zeigt die Pfarrkirche St. Ulrich von Nordrach. Vielen Menschen bin ich dort begegnet. Vielen, die noch eine recht gute Erinnerung an die Flößerei hatten. In Nordrach wohnt ein Mann, namens Riehle, noch in dem Haus, in dem seine Vorfahren als Flößer gelebt und gearbeitet hatten.
Das Haus ist ein echtes Flößerhaus.
Es ist anders gebaut, als die anderen Häuser. So konnte der damalige Dammwart von seiner Wohnstube stets den großen Damm beobachten, der vor dem Haus stand und das Wasser zurückhielt. Von dem Damm ist keine Spur mehr vorhanden. Früher war hier ein Engpass, der aber im Rahmen des Straßenbaues fort gesprengt wurde. Aber das habe ich erst viel später verstanden. Trotzdem stand ein Bild plötzlich vor meinen Augen, als ich an einem schönen Sommertag in Nordrach hoch über dem Gewann „Großweiher“ auf einer Wiese saß. Ich „sah“ den Damm vor mir, hörte das Wasser rauschen und „sah“ die Flößer auf ihrer gefährlichen Fahrt auf der kleinen Nordrach. Ein Gewitter rauschte herab, und ich fand in einer kleinen Hütte Schutz. Später suchte ich Herrn Riehle in seinem Haus auf, und wir standen gemeinsam an der Nordrach, als die Flutwelle den Bach herunterkam. Plötzlich sagte Herr Riehle neben mir: „Jetzt kommen sie die Nordrach herunter.
Nun begann die Suche nach der Wahrheit. Dichtung und Wahrheit gehören zusammen, aber niemals darf das eine das andere ganz vereinnahmen. Auf diese Suche möchte ich Sie in der nächsten Stunde mitnehmen
Meine Suche begann in Nordrach. Damit fing ich aber am Ende an. Wenn man so einen Faden in der Hand hält, weiß man nicht, ob man den Beginn des Knäuels oder das Ende in den Händen hat. Für mich waren es Gedenksteine, die mich faszinierten. Waldarbeit war eine gefährliche Arbeit und viele Menschen kamen dabei um. Umstürzende Bäume, aber auch der gefährliche Transport über die steilen Hänge forderten immer wieder Opfer. Die Steine, die ich im Wald fand, waren meist uralt. Jahreszahlen um 1700 bis 1800 fand ich darauf. Da war auch ein Gedenkstein, der mich sehr nachdenklich stimmte. 1805 waren viele Menschen nach Amerika ausgewandert. Um nicht vergessen zu werden, ließen sie einen Gedenkstein aufstellen. „Wir gehen, damit die anderen leben können“, stand darauf. „Wir gehen, damit die anderen leben können?“ Eine erstaunliche Inschrift. Was war tatsächlich hier in der Landschaft geschehen? Überall im Schwarzwald fand ich Reste einer hölzernen Technik. An einem verfallenen Gebäude an der Straße sah ich Reste eines riesigen hölzernen Zahnrades, das einmal zu einer Sägemühle gehörte. Die komplizierte Kraftübertragung vom Wasserrad an der Nordrach zur Sägemühle ist lange zerfallen, aber dieses hölzerne Zahnrad steht noch da. Ein hölzernes Zahnrad in dieser Größe? Nie hätte ich gedacht, dass ein Zahnrad aus einem anderen Material ist als Stahl. Aber nach und nach erkannte ich, dass es einmal eine Zeit gegeben hat, die man das hölzerne Zeitalter nannte. Im 18. und 19 Jahrhundert wurden viele Entdeckungen gemacht. Es war eine Zeit des geistigen Aufbruchs, eine Zeit der anscheinend unbeschränkten Möglichkeiten, aber der Rohstoff war Holz! Maschinen wurden erdacht, die Wasserkraft als die Energiequelle entdeckt, die bis in die fernsten Schwarzwaldtäler nutzbar war. An den Flüssen entwickelten sich Mühlen. Bei Mühle denken wir stets an Kornmühlen, aber es gab Tannenmühlen, die Rinde zu feinem Mehl zermahlten, das für die Gerberei verwand wurde, Gipsmühlen, die Stein zermahlten, Ölmühlen, Steinmühlen für Erze und Gesteine, Sägemühlen und natürlich auch Getreidemühlen. Die Zahl der Mühlen und Stampfen war riesengroß. Jeder noch so kleine Bach trieb sicher eine Mühle an. Was muss das für ein Geklapper im Schwarzwald gewesen sein. „Es klappert die Mühle im Schwarzwälder Tal“, heißt es in einem Lied. Das Klappern der Mühlen gehörte zum Schwarzwald wie das Rauschen der Tannen. Aber all die Maschinen und Geräte waren aus Holz gefertigt. Und nicht nur sie. Über die Ozeane fuhren große Segler und brachten Güter aus aller Welt nach Holland. Holland war damals eine Großmacht, welche die Welt beherrschte. Auch die Segler waren aus Holz. Ständig waren sie von Schiffbruch bedroht. Mit Staunen habe ich in dem Buch „Die mit Tränen säen“ der Neuenbürger Autorin Eva Nöldecke gelesen, dass man auf einer Schifffahrt nach Afrika mindestens einmal mit einem Schiffbruch rechnen musste. Erschüttert stand ich am Kap der Guten Hoffnung in Südafrika und sah den Felsen rund hundert Meter vor dem Strand, an dem Tausende von Schiffen gestrandet waren, die das Kap umrunden wollten. Wie oft kämpften dort am Kap der Stürme Menschen im tosenden Meer an einen Balken geklammert ums Überleben! Die Maschinen brauchten Holz, die Eisenwerke im Schwarzwald fraßen Holzkohle, die Schifffahrt rief nach Holz. Und die Holzhändler kamen und suchten festes Holz: Tannenholz als Masten und für den Schiffsrumpf und festes Eichenholz für die Spannten und Aufbauten auf den Schiffen, damit die den feindlichen Kanonen standhalten konnten. Dieser Holzhunger war es, der die Wirtschaft im Schwarzwald für über einhundert Jahre „brummen“ ließ. Dieser Holzhunger der Wirtschaft war es, der auch den kleinsten Schwarzwaldbach zu einem Floßbach verwandelte. Das hölzerne Zeitalter ist lange vorbei. Die industrielle Revolution verwischte die Spuren. Eisenbahnlinien und Straßen winden sich heute oft ganz nah neben den alten Wasserstraßen die Täler hoch. Sie beide, erst die Eisenbahn und dann die Straße, haben die alten Wasserwege, die einst die einzigen Transportwege waren vergessen lassen. Die hölzerne Technik wurde durch Eisen und Stahl ersetzt. Geblieben sind Erinnerungen an eine märchenhafte Zeit. Märchenhaft heißt nicht eine paradiesische Zeit. Wenn wir die Märchen einmal genau betrachten, dann erzählen sie von großer Not und vielen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, von entsetzlichen Hungersnöten, wenn Eltern ihre Kinder in den Wald bringen, um sie dort sterben zu lassen (Hänsel und Gretel).
Bei Wolfach fand ich die Erinnerungstafel an ein kleines Schwarzwalddorf namens „Hätt ich Brot!“, ein anderes Dorf heißt „Strohbach“, weil die Leute dort in selbstgebauten Elendshütten wohnten, von einem Dorf wird berichtet, dass sogar die Bettler einen Bogen darum machten, um nicht ausgeraubt zu werden. Aber auch von großen Hoffnungen und Glück ist in den Märchen die Rede, von Menschen, die in den Bergen nach Gold und Silber suchen, von guten und bösen Geistern und von Königssöhnen, die an einem Tag durch drei Königreiche reiten. Auch das habe ich erst verstanden, als ich die winzigen Herrschaften und die vielen Burgen im Schwarzwald kennen lernte.
Bekannt waren Fotos wie die „Heimkehr der Flößer“ .
Aber die Zeit blieb märchenhaft, bis man 1986 in Gengenbach, einer ehemaligen freien Reichsstadt
an der Kinzig
begann die Vergangenheit wieder zu entdecken. Aber mehr gab es nicht mehr.
Da war es ein kühner Schritt im alten Bahnwärterhäuschen das erste Flößermuseum zu eröffnen.
Es ist geradezu eine Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet in einem alten Bahnwärterhäuschen ein Flößermuseum eingerichtet wurde, war es doch die Bahn, die mit ihren eisernen Wegen die Wasserwege ablöste. Heute ist in dem Museum ein Flößer und ein Eisenbahnmuseum eingerichtet. Betrieben wird es von der „Flößergilde Schwaibach“. Ein altes Foto hängt dort vergrößert an der Wand und zeigt einen echten Schwarzwälder Flößer. Er trägt eine gewachste Jacke – sie wurde mit Bienenwachs getränkt und ist deshalb wasserundurchlässig – die hohen Stiefel und den breiten Hut. Neben ihm steht eine solche Wiede, wie ich sie hier auch habe. Schnüre wären den riesigen Belastungen, denen die Verbindungen zwischen den Gestören ausgesetzt sind, nicht gewachsen. Die Wieden bestehen aus gedrehten Baumstämmchen. Wir kommen später noch einmal darauf.
Hier in Gengenbach spielt auch der Roman „Wellenreiter“, den ich Ihnen vorstellen möchte.
Wie kann das damals gewesen sein?
Ein junger Mann aus Nordrach ist Großknecht geworden. Damit steht er endlich ganz oben auf der Liste der möglichen Hoferben. Nun könnte er endlich auch seine Maria, die Tochter vom Glasermeister Armbruster, heiraten. Aber alles kommt ganz anders:
1.Lesung aus dem Buch „Wellenreiter“:
So war ich wohl der erste, dem der große Mann auffiel, der mit langen Schritten über den Platz direkt auf den Abt zuging. Er schien keine Ehrfurcht zu kennen, denn er beugte nicht das Knie, als er vor dem Abt stand. Seine Stimme war ein gewaltiges Dröhnen, seine Beine standen wie Baumstämme in großen Lederstiefeln, sein Gesicht war von einem gewaltigen schwarzen Bart verdeckt und auf seinem Kopf saß ein hoher, schwarzer Hut. „Die Flößer warten an der Kinzig auf Euch, Abt“, dröhnte seine Stimme. Der Abt sah auf. Jetzt erst besann sich der große Mann und nahm seinen Hut ab. „Kommt“, sagte er mit deutlich leiserer Stimme, die aber immer noch über den Platz hallte und von den Kirchenmauern zurückgeworfen wurde. „Ich komme“, sagte der Abt. „Ihr wisst, was Ihr mir versprochen habt. Ich bin gespannt, ob Ihr Wort halten könnt.“
Die beiden kamen direkt auf mich zu. Ich war so verlegen, dass ich einfach stehen blieb. Der große Flößer erwartete, dass ich auswich, aber ich war wie angewurzelt. Schon baute er sich vor mir auf und sah mich mit finsteren Blicken an. „Aus dem Weg“, brüllte er.
„Mein Sohn, hat er einen Wunsch?“, sagte da der Abt, der neben ihm ging, und hielt mir seinen Ring hin. Ich beugte das Knie und küsste den Ring inbrünstig. „Ich bin der Großknecht vom Stollengrund“, murmelte ich. „Ich habe eine Kuh als Zehnten gebracht.“
„Danke, dann gehe in Frieden“, murmelte der Abt und wollte schon weitergehen. Ich weiss nicht, was mich trieb, aber ich fragte: „Kann ich Euch zur Kinzig begleiten?“
Der Abt sah auf mich nieder. Ich spürte seinen Blick in meinem gebeugten Nacken. Wahrscheinlich lächelte er über meinen Wunsch. Wie eine Ewigkeit schien mir die Zeit, die er mich knien ließ. Dann hörte ich seine gütige Stimme. „Gern, mein Sohn, begleite er uns. Wir werden seine Dienste brauchen, aber stelle er sich das nicht einfach vor.“
Ich spürte, wie ich rot wurde. Was hatte ich getan? Ich war doch der Großknecht vom Stollengrund, und jetzt hatte ich meine Dienste dem Abt angeboten. Was hatte ich nur getan?
„Steh er auf“, sagte der Abt. In seiner Stimme klang Ungeduld. Linkisch erhob ich mich und folgte den beiden, dem Abt und dem großen Flößer. Seltsam, mir war nie vorher aufgegangen, wie groß ich selber war. Jetzt, wo ich den beiden folgte, stellte ich fest, dass ich dem Flößer an Größe kaum nachstand. Unwillkürlich verfiel ich in den gleichen ruhigen Schritt. Es mag seltsam ausgesehen haben: Der Abt, der nach allen Seiten die Menschen segnete, der gewaltige Flößer neben ihm, der den Menschen Furcht einjagte, und dahinter, in gebührendem Abstand, ein Bauernknecht, die graue Mütze auf dem Kopf.
Wir hatten nun die Klosteranlage verlassen und gingen an der Stadtmauer entlang zur Kinzig. Ich merkte, dass die Leute nicht mehr niedersanken, wenn der Abt ihnen begegnete. Sie blieben stehen, gingen zur Seite oder wandten sich ab. „Wir sind jetzt auf dem Gebiet der Reichsstadt Gengenbach“, sagte der Abt zum Flößer gewandt. Über das breite Gesicht des großen Mannes flog ein Grinsen, als er antwortete: „Ich sage Euch, Ihr müsst Eure Macht ausbauen, Abt, wenn Ihr Erfolg haben wollt.“ Meine Ohren wollten nicht glauben, was ich da hörte. Da sagte jemand einfach „Abt“ und nicht „Hochwürden“ oder „Monsignore“, sondern einfach „Abt“. Welche Macht musste dieser Mann über den Abt haben! War es am Ende der Teufel selbst? Wir gingen über die Zugbrücke von Gengenbach hinaus an die Kinzig. Ein scharfer Wind wehte das Tal herauf. Am Fluss standen Gruppen von Männern. Sie trugen die schwarze Kleidung der Flößer: lederne Hosen, schwarze Lederwesten und große schwarze Hüte, aber vor allem gewaltige Lederstiefel. Sie sahen auf, als sie uns hörten, und warteten ab. Keiner von ihnen beugte die Knie, als der Abt ungeschickt den Hang zu ihnen hinunterstieg. Einige zogen ehrfurchtsvoll den Hut, aber die meisten schauten unverwandt auf den großen, schwarzen Mann in unserer Begleitung. Mich selber schien niemand wahrzunehmen.
„Nun, Michel“, fragte einer der Männer, der wohl der Anführer war. „Warum hast du den Abt in deiner Begleitung?“ Die anderen Flößer grinsten spöttisch. „Wer ist das?“, fragte der Mann weiter und zeigte in meine Richtung. Ich drehte mich um, weil ich jemanden hinter mir vermutete. Aber da war niemand. „Ich meine ihn“, sagte er jetzt direkt zu mir.
„Ich bin der Großknecht vom Stollengrund“, stammelte ich. „Und warum ist er dann nicht bei seinen Kühen?“, fragte der Mann, und die Flößer lachten. Ärger stieg in mir hoch, und ich entgegnete kühn: „Ich will Flößer werden. Darum bin ich hier.“ Ich weiß nicht, was mich trieb. Ich war gerade erst Großknecht geworden und am Ziel meiner Wünsche, und jetzt bewarb ich mich als Flößer. Immerhin schienen meine Worte Eindruck zu machen. „Dann komm.“ Der Mann winkte mich heran. Als ich vor ihm stand, legte er seine schwere Hand auf meine Schulter. Ich war größer als er, stellte ich erstaunt fest. „Nun, wie heißt er?“ „Hans“, antwortete ich. Ich wagte nicht, ihm ins Gesicht zu sehen. „Ein Flößer muss sich auf einem fahrenden Baumstamm halten können!“, fuhr er fort, ohne die Hand von meiner Schulter zu nehmen. „Kann er das?“ Ich nickte. Noch nie hatte ich auf einem Baumstamm im Wasser gestanden. Wo auch? An der Nordrach reichte das Wasser nicht aus, um Bäume schwimmen zu lassen. „Dann komm!“ Er schob mich zur Kinzig hinunter. Riesige Tannen lagen in einem angestauten Becken. „Das ist der Hafen“, erklärte er zum Ufer gewandt. „Hier werden die Gestöre gebunden, die als Waldflöße die Bäche herunterkommen.“ „Halte keine Predigt!“, rief jemand, und ich wurde kräftig zum Wasser gestoßen. Ich musste auf die Baumstämme springen, wenn ich nicht ins Wasser fallen wollte. Ich traf einen Baum mit beiden Beinen, aber ich rutschte mit meinen Schuhen ab. Aber der Stamm begann sich unter mir zu drehen, und ich ruderte mit den Armen, um mich zu halten. Vom Ufer her grölten die Flößer. Ich wollte nicht fallen. Ich musste es schaffen. Nach wenigen Schritten auf dem glatten Baum spürte ich, wie der Baum auf mein Kommando gehorchte. Ich konnte den Stamm nach meinen Wünschen bewegen! Das Gegröle wich einer bewundernden Stille. „Spring an Land“, rief der große Flößer, den sie Michel nannten. Ich sprang sofort, aber natürlich zu kurz, weil ich nicht bedachte, dass ich die Stämme ins Becken hinausschob. Die Flößer brüllten vor Lachen, als ich ins Wasser fiel. Die braunen Wogen schlugen über mir zusammen und nahmen mir den Atem. Ich hatte schon Angst in den Fluten zu ertrinken, als ich spürte, wie eine kräftige Hand mich am Hosenbund packte und an Land warf. Wie ein nasser Sack lag ich am Ufer und spuckte das braune Wasser. „In zwei Wochen bauen wir ein Floß. Sei am Morgen mit Sonnenaufgang da. Kannst gehen!,“ donnerte Michels gewaltige Stimme über mir. Ich sah auf. Michel hielt mir seine Hand hin, und ich ergriff sie mutig. Mit einem kräftigen Schwung zog er mich hoch. Seine schwarzen Augen sahen mich durchdringend an, aber dann wandte er sich ab und ließ mich stehen. Niemand beachtete mich mehr. Nachdenklich stieg ich den Hang nach Gengenbach hoch. Ich hörte noch, wie der Abt zu den Flößern sprach. „Wir wollen unsere Besitzungen in Nordrach der Flößerei öffnen. Dieser Flößer, Michel , hat mir seine Hilfe angeboten. Unsere Flöße wollen wir dann in Gengenbach binden lassen und nach Willstätt bringen. Dazu brauchen wir die Zustimmung der Schifferschaft Gengenbach. Können wir darauf bauen?“ Heimlich beobachtete ich sie. Ich musste einfach mehr hören. Der Abt wurde von den Flößern umringt. So standen die Bauern, wenn sie einen Handel abschlossen. So stand niemand seinem Herrn gegenüber. Ich verstand die Welt nicht mehr. Gab es nicht Herren und Knechte? Waren die Knechte auf einmal auch Herren? Auf der Nordrach sollte geflößt werden? Vorstellen konnte ich mir nicht, was sie meinten. Der große Flößer gab dem Anführer der Schifferschaft die Hand und der Abt legte seine Hand darauf. Der Pakt war geschlossen. Was sollte ich daheim erzählen? Niemand würde mir glauben. Ich stieg den Hang hoch, als der Abt mich zurückrief. „Stollenknecht“, rief er. „Komm er zu uns! Er hat mehr gesehen, als er sollte. Aber nun ist es gut so. Er gehört ja auch dazu. Berichte er auf dem Hof, was er gesehen hat, und richte er dem Pfarrer aus, dass ich am kommenden Sonntag nach Nordrach komme. Es gibt viel zu planen. Wird er das behalten?“
Ich nickte. Die Gedanken kreisten in meinem Kopf wie die Raben über der Kinzig. Wie sollte ich das alles meinem Vater erzählen? Am Morgen war ich mit den Glasern als Großknecht vom Hof nach Gengenbach gezogen, und nun kam ich als Flößer des Abts heim. Ich fror nicht nur, weil der kalte Wind meine Kleidung trocknete. Die Flößer stimmten ein kurzes Lied an. Es war wohl ihr Ruf, mit dem sie sich bei der schweren Arbeit Mut machten. In den Juchzer am Schluss stimmte ich ein, und ich warf meine nasse Mütze hoch, wie sie ihre schwarzen Hüte in die Luft warfen. „Ich werde es ausrichten“, rief ich dem Abt zu und trampelte auf der Stelle, um mich zu wärmen. „Gott segne ihn, mein Sohn“, antwortete er und gab mir mit dem Kreuzzeichen seinen Segen. Michel sah mir spöttisch grinsend zu. „Er wird uns helfen“, rief er zu mir herüber. In diesem Augenblick spürte ich, dass ich nicht nur mit dem Abt, sondern auch mit dem Teufel einen Pakt geschlossen hatte.
Soweit die Lesung aus dem Roman.
Als die Flößerei vorbei war, hat der Fotograf Blumenthal aus Wildbad erkannt, dass die Flößerbilder nur noch einmal möglich waren. Deshalb hat er viele Begebenheiten nachstellen lassen und fotografiert. Aus seiner Sammlung stammen fast alle Bilder, die heute in den Flößermuseen sind.
Das Bild zeigt die Ausrüstung der Flößer mit dem unvermeidlichen Fässchen, denn die Flößer waren sehr durstige Leute. Täglich rannen einige Liter Schnaps, Wein und Bier durch ihre Kehle. Es ist vielleicht eine interessante Beobachtung, dass die Männer zunächst Schnaps tranken und zwar literweise, genauso wie wir es von den Aussiedlern aus Russland kennen, die in jener Zeit ausgewandert sind. Sie haben die Trinkgewohnheiten ihrer Vorfahren beibehalten. Hier im Schwarzwald gründete der Abt Fürst Gebhard von St. Blasien die Rothausbrauerei, um den Flößern und Holzhauern ein billiges, gesundes Getränk anzubieten, dass sie vom Schnaps fortbrachte. Die Klöster – z. B. Alpirsbach – dachten ähnlich und brauten Bier!
Das zweite Flößermuseum entstand in Wolfach. Dort hängt auch eine alte Tafel, die an die älteste urkundliche Erwähnung der Flößerei erinnert. „Das Volk so an der Kinzig wohnet besonders um Wolfach ernähret sich mit den großen Baumhölzern, die sie durch das Wasser Kynzig gen Straßburg und den Rhein flözen und groß Geld jährlichen erobern.“
Eigentlich geht der Spruch weiter:
Deßgleichen tun die von Gerspach und anderen Flecken, die an der Murg gelegen seind, die das Bawholz durch die Murg an den Rhein bringen, wie die von Pforzen durch die Entz gross Flötz in Neckar treiben!
Die Flößerei auf der Kinzig ist also viel älter als das angesprochene 18. und 19. Jahrhundert. Schon in der Römerzeit wurden die Flussläufe benutzt, um Baumstämme zu Tal zu bringen.
Auch die Römer haben schon auf der Enz, der Nagold und dem Neckar geflößt. Für ihre Bauwerke, ihre Städte und ihren Bedarf brauchten sie viel Holz, auch als Heizung im kalten Germanien. Aber die Anlagen an den Flüssen sind aus Holz und Stein und Erde gebaut und nicht für die Ewigkeit. Ganz sicher war alles wohl organisiert: Es gab Flößergilden, wie der Neptunstein gefunden bei Ettlingen zeigt. „Contubernia nautarum“ nannten sie sich, Schifferschaft, genau wie die Flößervereinigungen späterer Jahrhunderte.
Neuere Grabungen bei Kappelhof bei Pforzheim haben auch Kanäle nachgewiesen, in denen die Römer flößten, denn die Schwarzwaldbäche sind eigentlich für die Flößerei ungeeignet. Aus den Bächen mussten erst Wasserstraßen werden.
Trotzdem ist die große Zeit der Flößerei jene Zeit, die man das „hölzerne Zeitalter“ nennt. Erst dann wurden die Flussläufe ausgebaut zu Wasserstraßen mit einer ausgeklügelten Technik.
Im Flößermuseum Wolfach ist das Modell eines alten Floßes ausgestellt. Es zeigt: Die Baumstämme mit dem typischen Fischmaul, die Wieden, die sie zusammenhalten, die Deckladung, die möglich war, die Flößerhaken und die hohen Flößerstiefel. Diese sind aus mehreren lagen Leder gefertigt. Da man noch keinen Kunststoff hatte, legte man Schweinsblasen zwischen die Lederlagen und machte sie so weitgehend wasserdicht. Trotzdem mussten die Schuhe regelmäßig gefettet werden. Dazu reichte natürlich nicht eine Tube Schuhcreme, sondern vor der Tür eines Flößers stand das „Fettnäpfchen“, das groß genug war, auch versehentlich hineinzutreten!
Die Flößerei gestaltete nach und nach alle Schwarzwaldbäche um. Heute noch sind Reste der alten Bauten erhalten. Jeder Fluss erforderte eine andere Technik. Deshalb möchte ich Ihnen nach und nach die wichtigsten Flüsse und ihre spezielle Eigenart vorstellen.
Ich beginne mit der Kinzig. Sie entspringt oben bei Loßburg in einem sagenhaften See. Als der See noch im tiefen Wald versteckt war, vermutete man dort Elfen und Nymphen. Auch wenn der lichte Wald heute das alles so fern erscheinen lässt, sitzt heute an Sonn – und Feiertagen eine moderne Märchenerzählerin an der Kinzigquelle und erzählt den Besuchern von den Gefahren des Kinzigsees und dem armen Bauernburschen, dem die Kinzigfee zu einer Mühle in Loßburg verhalf, weil sie ihm einen Weg zeigt, durch den er Wasser nach Loßburg bringen konnte. Das Wasser der Kinzig bahnt sich durch ein enges Tal den Weg nach Schiltach.
Schiltach ist die erste große Stadt, direkt an der Kinzig. Wahrzeichen ist die im 19. Jahrhundert erbaute große evangelische Stadtkirche. Schiltach nennt sich eine Stadt der Gerber und Flößer. In zweijährigem Rhythmus feiert die Stadt ein Flößerfest, denn auf der Schiltach kamen einst die Flöße von Schramberg und von Schenkenzell die Flöße auf der Kinzig. In Schiltach fließen die Flüsse zusammen. Die Flöße wurden neu zusammengebaut. Man findet heute noch den Kanal, in dem die Flöße an der Stadt herumgelenkt wurden. Der Kanal erhielt Wasser aus der Kinzig, wie auch die Gewerbekanäle für die Mühlen. Die Wasserrechte waren ganz genau geregelt und natürlich musste eine Maut für die Benutzung des Wasserweges entrichtet werden, denn die Wasserstraßen waren in Privathand. Schiltach ist nach mehreren verheerenden Stadtbränden immer noch eine Stadt des Fachwerks und damit aus dem Holz gebaut, das einst die Wasserstraßen herunterkam.
Am Gasthaus Brücke ehrt ein Bild die Erinnerung an die großen Flößerfamilie Trautwein. Die typische Tracht der Schiltacher war die rote Jacke. Diese Flößerkleidung war sehr wichtig, weil für jedes Floß gezahlt werden musste und weil die Anzahl der Flöße auf der Kinzig unter den Schifferschaften sehr genau aufgeteilt war. Die Menschen lebten nicht in der Landschaft wie heute, sondern von der Landschaft, die nur mit Mühe die große Bevölkerung ernähren konnte. Deshalb war jeder Wassertropfen und jeder Grashalm verteilt. Genauestens wurde auf die Einhaltung der Rechte geachtet, denn nur so konnten alle leben. Die Kinzig herunter geht es nach Wolfach. Die Flößergilde ist sehr stolz auf die Tradition ihres Städtchens. Für die Wolfacher sind die schwarzen Westen üblich. Das ganze untere Kinzigtal trägt man bis Willstätt die schwarzen Westen. Natürlich hat Wolfach nicht nur das Flößermuseum, das eben schon erwähnt wurde, sondern auch einen Floßpark an den ehemaligen Hafenanlagen der Stadt. Dort steht auch ein großes Floßmodell, das besser erklären lässt, wie man geflößt hat. Ein Floß bestand immer aus mehreren Gestören, die durch Wieden gelenkig miteinander verbunden waren. Nur dadurch war es möglich, den engen Biegungen des Flusslaufes auch zu folgen. Gesteuert wurde das Floß mit einem großen Ruder am Kopf des Floßes, mit dem beweglichen ersten kleinen Gestör und gebremst mit dem Sperrriegel am Schluss des Floßes. Um das Floß zum Stillstand zu bringen, warf man Anker in das Ufergebüsch. Auf jedem Gestör stand ein Flößer mit hohen Stiefeln und Floßhaken, um das Floß in der Strömung zu halten. Da die Kinzig normalerweise zu wenig Wasser hat, um ein Floß darauf treiben zu lassen, wurde das Wasser hinter Wehren gestaut. Das Wehr wurde mit dem Galgen geöffnet. Mit dem Wasserschwall fuhr das Floß das mitunter steile Wehr hinunter.
Die Fahrt durch ein Wehr war schwierig und gefährlich. Der Mann am Sperrriegel auf dem letzten Floß musste versuchen, das Floß gestreckt zu halten. Er musste den „Ritt auf der Welle“ ermöglichen.
So eine Floßfahrt war gefährlich. Es ging um Leben und Tod, um Gesundheit oder schwerste Verletzungen und immer um das Ganze. Wenn ein Floß liegen blieb, war es verloren. Wenn es aufgegeben werden musste, dann durften sich die Anwohner das Strandgut holen. Bei „Gelbbach“ bei Oberwolfach an der Wolf gab es einen Müller, der als „listig“ bezeichnet wurde. Auch die Wolf brauchte den „Schwall“, um befahrbar zu sein. Er war eigentlich verpflichtet, seinen Mühlenteich abzulassen, um den Flößern den nötigen Schwall zu geben, aber er erhöhte die Gebühr um ein Fässchen Wein. Wenn er es nicht bekam, öffnete er „versehentlich“ das Wehr seiner Mühle zu spät, und die Flößer saßen auf dem Trocknen. Natürlich gab man ihm, was er verlangte. Einer war dem anderen ausgeliefert.
Die Wolfacher fuhren meist nur bis Gengenbach und übergaben die Flöße dort an die Gengenbacher. Die Gengenbacher veranstalteten 1984 ein großes Flößerfest. Zum ersten Mal seit einhundert Jahren fuhr wieder ein Floß auf der Kinzig.
Der Abt von Gengenbach war es, der die kleine Nordrach schiffbar machen ließ und so seine Waldungen in Nordrach nutzte. Über den Berg kommt man von Nordrach nach Gengenbach, aber auf der Wasserstraße ist es ein weiter Weg. Die Übergabestationen lagen so, dass die Flößer nach zwei bis drei Tagen zu Hause sein konnten. So lange dauerte die Fahrt für lange Zeit auf der Kinzig, die mit vielen Armen das weite Tal durchströmte, von Wolfach nach Gengenbach!. Die Begradigung der Kinzig verkürzte die Strecke auf einen knappen Tag! Aber sie nahm den Gengenbachern das Geschäft, denn nun fuhren die Wolfacher und Schiltacher bis Willstätt in das große Wehr. Von den Floßanlagen zu Gengenbach ist nichts mehr erhalten. An der Stelle des Floßhafens wurde mit der Kinzigbegradigung ein großes Wehr errichtet. Auch heute noch spielt die Wasserkraft an den Schwarzwaldflüssen eine große Rolle. Viele kleine Wasserkraftwerke erzeugen billigen Strom für die Fabriken. Um die Wasserrechte wird auch heute noch hart gestritten.
Bei Ortenberg liegt das große Offenburger Wehr Hier zweigt der große Offenburger Kanal ab. Er umgeht eine weite schwierige Strecke auf der Kinzig, aber auch er ist natürlich eine Privatstraße, die von der freien Reichstadt Offenburg angelegt wurde, um Geld einzunehmen. Gleichzeitig ist dieser Kanal auch der Gewerbekanal für Offenburg. Zahlreiche Mühlen, eine Bleiche für Wäsche und Garn, eine Färberei, mehrere Schlachtereien und Gerbereien. Alles lag an dem Kanal, teilte sich das Wasser und zahlte Gebühren für die Nutzung. Die Nutzung des „Mühlbaches“ war ganz streng geregelt. Der Kanal hat einen genau festlegten Querschnitt. Die längsten Tannen, die durch den Kanal gebracht werden konnten, hatten 100 Fuß = 33 m Länge. An den älteren Kanälen sind das auch die Maße der Schleusen. Der Kanal umging die sumpfigen Gebiete der Kinzig und garantierte immer gleichen Wasserstand. Damit war man von dem Schwall und Hochwasser – oder Niedrigwassergefahren unabhängig. Erheblich weniger Flößer konnten ein langes Floß steuern. Damit gingen zwar Arbeitsplätze verloren, aber man sparte auch Personalkosten. Es ist erstaunlich, wie sich so alte Vereinbarungen mit modernen Begriffen erklären lassen.
Durch den Kanal steuerten drei bis vier Flößer ein über zweihundert Meter langes Floß. Auf der Kinzig brauchte man 12 bis 15 Mann für das gleiche Floß!
In Willstätt endete der Kanal am berühmten Wehr. Das Wehr war etwa vier Meter hoch und nur für Willstätter durchfahrbar, die damit auch ihr Revier abgrenzten.
Heute steht an dem Wehr eine große Mühle, ein modernes Kraftwerk und die Erinnerung an ein altes Kraftwerk. Früher gab es dort verschiedene Mühlen und zwei Gasthäuser: Eins für die Wolfacher und ein für die Schiltacher, denn die vertrugen sich nicht. Die Wolfacher waren katholisch und die Schiltacher evangelisch. Ich weiß nicht, ob Sie noch den unseligen Streit aus Ihrer Kinderzeit kennen.
Wie mag die Einfahrt in das Willstädter Wehr erlebt worden sein?
Für meinen Romanhelden stelle ich sie mir so vor:
2.Lesung aus dem Roman „Wellenreiter“:
Nun bekamen wir Anfänger unsere Chance. Mein Herz hüpfte vor Freude. Von Gengenbach bis Willstätt war die Kinzig ruhig genug, dass auch Neulinge ein großes Floß steuern konnten. In Ordnung, wir würden das Floß übernehmen, wir hatten lange genug mit Haken und Stange geübt. Himmelsbach ging voraus ans Kinzigufer. „Josef, du übernimmst das Steuer“, sagte er. „Du kennst die Kinzig. Ihr habt Eichenstämme im Floß. Euer Floß liegt sehr tief und ist schwer zu steuern. Also passt auf! Die Holländer erwarten euch in Willstätt. Dort macht ihr das Floß am Wehr fest und geht in das Gasthaus „Adler“. Dort bekommt ihr den Lohn und Speise wie immer. Hans, du übernimmst den Riegel. Im Falle eines Falles brauchst du viel Kraft. Also, „Jockele sperr!“ Grinsend schlug er mir mit der breiten Hand auf mein ledernes Wams. Josef war der älteste und erfahrenste Flößer von uns. Er stieg als erster die Flussböschung hinunter. Wir folgten ihm. Dort lag das Floß. Sieben Gestöre konnte ich zählen. Auf dem Afterfloß standen allerlei Kisten. Proviant und Ladung der Wolfacher. Die gewaltigen Eichenstämme lagen zwischen den Tannenstämmen, die sie so trugen. Ich sprang auf das Floß und prüfte den Riegel. Josef ging von Gestör zu Gestör und prüfte die Wieden. Die Wolfacher hatten gute Arbeit geleistet. Der Riegel war fest in den Flussgrund getrieben. So einen Riegel hatte ich noch nie gesehen. Er war ganz aus rotem Eichenholz gearbeitet und trug Messingbeschläge. Dieser Riegel gehörte sicherlich dem Floßherrn. Der Wasserspiegel der Kinzig hob sich deutlich, irgendwoher kam eine Welle den Fluss herunter, das Floß wurde unruhig. Wir mussten die Welle nutzen, um unser Floß sicher durch die Untiefen zu bringen. Josef hatte die Welle auch gesehen. „Jockele, sperr“, rief er. Wir sprangen auf das Floß, nahmen unsere Stangen und versuchten, das Floß vom Ufer zu lösen. Ich zerrte an dem Riegel, um ihn aus dem Boden zu bekommen. Die anderen rissen die Anker aus dem Boden am Ufer. Dann wandte sich das Floß langsam in die Flussmitte. Mit aller Kraft gelang es mir nicht, den Riegel hochzuziehen. Schon klatschte die Welle gegen das Floß. Es war höchste Zeit. „Jockele auf“, schrie Himmelsbach vom Ufer. Er sah meine Schwierigkeiten, aber er konnte mir auch nicht helfen. Da sah ich eine Buchenkatze auf dem Floß liegen. Blitzschnell ergriff ich sie und holte zu einem gewaltigen Schlag aus. Ich traf den Sperrriegel gut, und ächzend bewegte er sich etwas zur Seite. Da ergriff ich ihn mit beiden Händen und konnte ihn endlich hochziehen. Knarrend setzte sich das Floß in Bewegung. „Verliere die Welle nicht, Wellenreiter!“, rief Himmelsbach. „Dann trägt sie euch bis Willstätt!“
Zum ersten Mal ritten wir nun auf einer Welle die Kinzig hinunter. Von den Bergen grüßte die Michaeliskapelle und später die Burg Ortenberg. Dann traten die Berge zurück und unsere Fahrt wurde langsamer. Immer wieder fuhren wir über kleine Wehrstufen, die den Lauf der Kinzig bremsen sollten. Bald lagen die Kinzigberge hinter uns. Die Stadtmauer von Offenburg kam näher. Schon konnte man die großen Hafenanlagen sehen. „Jockele sperr“, schrie der Floßführer. Mit aller Kraft trieb ich den Riegel in den weichen Untergrund. Unser Floß verlangsamte die Fahrt. Wir waren gerade an der Ufermauer angekommen und stießen uns mit den Stangen fest in den Boden, da sprang schon ein Mann in Uniform an Bord. „Der Zöllner“, rief Josef. Mit seinem großen Zirkel ging der Mann über das ganze Floß und wie ein Taktstock schwang sein Zirkel hin und her. Dann sprach er Josef an. Ich konnte den Preis nicht verstehen, aber Josef jammerte laut: „So lohnt doch der Handel auf der Kinzig nicht mehr!“ Umständlich kramte Josef die geforderten Münzen heraus und gab sie dem Zöllner. „Jockele frei!“, schrie er dann, und wir griffen nach den langen Stangen. Mit aller Kraft stemmten wir das Floß ins freie Wasser. Auf der Stadtmauer erschienen neugierige Gesichter, die unsere harte Arbeit begutachteten. Mancher böse Witz flog hin und her, bis wir endlich das lange Floß wieder im freien Wasser hatten. Die Welle, die uns nach Offenburg getragen hatte, war lange verebbt, und wir mussten nun mit den Stangen das Floß in Fahrt bringen. Wir arbeiteten Stunde um Stunde, um voranzukommen. „Das Straßburger Münster!“, rief Josef plötzlich von vorn. Die anderen kletterten auf die Eichenstämme, um besser zu sehen. Da wir endlich langsam in Fahrt waren, wagte ich nicht, den Sperrriegel zu verlassen. In der Ferne konnte ich die Spitze eines Kirchturms erkennen. Das war also das berühmte Kennzeichen der Rheinebene. Die Kinzig floss nun in breiten Schleifen dem Rhein zu. Josef fuhr stets in der Flussmitte, und ich musste immer wieder leicht die Fahrt bremsen, damit unser Floß lang gestreckt die Kurven nahm. Der Riegel ließ sich jetzt wunderbar leicht bedienen und kratzte gemächlich in den Bodensteinen der Kinzig. Hinter uns wirbelten Schlamm und Kies auf. Fische aller Art schwammen am Floß entlang. Krebse und Muscheln wurden vom Grund gerissen. Man hätte mit der bloßen Hand ernten können. Aber auf uns wartete in Willstätt besseres als Muscheln, Krebse und Kleinfisch. Eine kleine neue Welle lief den Fluss herunter und nahm uns die schwere Arbeit des Stakens ab. Die Männer an den Stangen konnten sich ausruhen. Das Floß schaukelte Willstätt zu. Das war sicher gut, denn in Willstätt würden wir jede Hand und alle Kraft brauchen, das Floß zu verankern. Willstätt, das Wehr und die große Mühle! Wie oft hatten wir in Gengenbach darüber gesprochen. Bei jeder Erzählung wurde das Wehr gefährlicher und die Mühle größer. Morgen würde ich beides sehen und vielleicht doch bis an den Rhein fahren! „Jockele sperr! Jockele sperr! Schläfst du!“, schrie Josef und riss mich aus den Träumen. Die anderen sprangen von den Eichenstämmen und nahmen ihre Stangen. Ich stemmte mich in den Riegel, ohne den Grund zu kennen. Aber dann sah ich auch schon den großen Baum, der sich in der Kinzig verfangen hatte und uns den Weg versperrte. Ein Sturm hatte eine gewaltige Pappel vom Ufer in die Kinzig geworfen und wir mussten versuchen, an ihr vorbeizukommen, ehe uns ihre starken Äste abfingen. Die ersten Äste ratschten schon an den Eichen und unten am Gestör. Auch ohne mein Zutun verlangsamte sich die Fahrt. Die Männer nahmen die Floßhaken und schoben die Äste zur Seite. Nikolaus hatte ein Breitbeil in der Hand und schlug an Ästen ab, was ihm in den Weg kam. Gestör für Gestör kamen wir an dem Baum vorbei. Immer auf der Hut, dass nicht zwischen den Gestören ein Ast auftauchte und uns voll ausbremste. Endlich waren wir vorbei. „Gut gemacht, Männer!“, rief Josef von vorn. „Das war knapp! Unsere Welle haben wir verloren!“ Ich sprang auf die Eichenstämme und schaute nach vorn. Die Welle war jetzt deutlich vor uns. Am Ufer sah man, wie sie eilig die Kinzig hinunter lief. „Bei einem Waldfloß säßen wir nun auf dem Trocknen“, sagte Nikolaus und kam über die Stämme zu mir. „Trotzdem, du hast deine Arbeit gut gemacht, Wellenreiter.“ Ich wusste, dass er schon bei so mancher Floßfahrt dabei gewesen war, sein Lob galt sehr viel. „Nenn mich nicht Wellenreiter“, sagte ich. „Ich heiße Hans!“ „Wellenreiter passt besser“, lachte er. „Wer versteht es besser auf der Welle zu reiten als der Mann am Riegel? Warte, bis du einmal ein Waldfloß zu Tal bringst, dann wirst du verstehen.“ Er nahm eine lange Stange und ging an die Flussseite. Peter stand an der rechten Seite. Gemeinsam stießen sie die Stangen erneut in den Boden und stemmten sich dagegen. Es dauerte lange, bis wir wieder an Fahrt gewannen. Peter und Nikolaus legten sich mächtig ins Zeug, um die Welle wieder zu erreichen, aber sie blieb unerreichbar. Als die Sonne unterging, tauchte eine kleine Hütte am Ufer auf. „Wir legen an!“, rief Josef. „Werft die Anker!“ Ich trieb den Riegel tief hinunter, und knirschend bremste er. Die anderen hielten die Anker in den Händen und warteten auf das Kommando. „Jetzt!“, schrie Josef. Alle warfen ihre Anker ans Ufer. Sie schlugen klatschend in die Gebüsche ein. Die Seile spannten sich sirrend fast bis zum Reißen. Wir hielten uns fest, denn mit einem Ruck stand unser Floß. Wir sprangen ans Ufer, und Josef vertäute das Floß. Die Hütte war alles andere als bequem. Sie reichte gerade als Schlafplatz für uns Männer, wenn wir nah beieinander lagen.
Die Willstädter fuhren durch ihr Wehr die Flöße bis Kehl an den Rhein, oder nach Straßburg oder bis Steinmauern. Man achtete auf die Wegstrecken. Außerdem verlangten die Floßherren, dass jeder Flößer verheiratet sein musste, „denn nur dann kommt er nach Hause“, hieß es. Flößer galten als sehr unstete Gesellen. Dazu muss man bedenken, dass die meisten Menschen ihr Dorf nicht verlassen durften, weil sie zu einem Dorf oder Gut gehörten. Man kaufte ein Dorf, eine kleine Grafschaft und die Menschen dazu. Was wäre geschehen, wenn man den Menschen erlaubt hätte, ihr Dorf zu verlassen? In einer Zeit, in der Reisen gefährlich und beschwerlich war, galt der schon als weitgereist, der 30 km entfernt gewesen war. Fernreisende wie Goethe waren meist nur Adelige, die sich das auch leisten konnten. Flößer erzählten deshalb von weit entfernten Gegenden, wenn sie vom Rhein sprachen oder ihn gesehen hatten. Und Holland? Das waren nur wenige ganz wagemutige Flößer, welche die weite Fahrt gewagt hatten und nach Hause zurückkehrten. Flößer! Das waren Menschen, denen man nicht so ganz traute. Nicht umsonst ist der Schwarzwälder Michel, oder Holländer Michel ein unsteter Geist, dem man sich nicht anvertrauen darf. Freundlicher und zuverlässiger ist das Glasmännlein, das auch wundertätig ist, denn wie könnte es sonst aus Salz und Sand durchsichtiges Glas machen? Wie könnte es sonst am heißen Glasofen stehen, wenn es nicht irgendetwas mit Himmel und Hölle zu tun hätte? Aber die Flößer, das waren schon raue Gesellen. Die Willstätter flößten bis Kehl oder Straßburg oder höchstens bis Steinmauern. Steinmauern war für die damalige Flößerei das wichtigste Dorf am Rhein. Hier fließt die Murg in den Rhein.
Im Holländer Hafen wurden die größeren Rheinflöße zusammengebaut. Vor der Rheinbegradigung durch Tulla hatte der Rhein so viele Arme und ständig neue Untiefen, dass sich nur Anwohner wirklich in dem Gewirr auskennen konnten. Die Steinmaurer Flößer waren eine große Zunft! Sie trugen volle Stolz ihre flachen Hüte und blauen Jacken.
Der Holländer Hafen ist heute lange verfallen und kaum noch erkennbar. Aus dem Floßkanal, den die Steinmaurer einst bauten, um die Flöße zu ihnen zu lenken, ist heute die Altmurg geworden, ein Abwasserkanal, der an der ehemaligen Mauer entlang führt. Zu erkennen ist noch der dreieckige Querschnitt des Kanals, der bei wenig Wasser möglichst große Oberfläche hat, um die Flöße tragen zu können.
Die Kirche von Steinmauern heißt heute „Zur Kreuzerhöhung“ zur Erinnerung an den 14. September, dem Gedenktag der Kirche an die Aufstellung des Kreuzes Christi in Konstantinopel. Früher war sie
St. Nikolaus geweiht und damit eine echte Flößerkirche. Nikolaus ist der Flößerheilige. Ihm vertrauen sich alle Schiffer und damit auch die Flößer an. Sie empfanden sich den Wellen genauso ausgeliefert wie die Seeleute. Die Gefahr des Ertrinkens in den Fluten der Flüsse stand ihnen immer wieder vor Augen, und nicht wenige Flößer sind so bei ihrer schweren Arbeit umgekommen. Auf den Brücken – wie in Wolfach – findet man oft St. Nepomuk als einen zweiten Wasserheiligen. Ihn bat man um Schutz in Wassernot, die es an den Flussläufen oft gab, aber bei persönlichem Schutz wandte man sich doch lieber an den heiligen Nikolaus. Wo immer Nikolauskapellen da sind, da gab es auch Flößerei. An der Grund – und Hauptschule in Steinmauern erinnert ein wunderbares Bild an die Flößerei, die in diesem Dorf nicht vergessen wurde. Die schwere Arbeit der Flößer wird in einer erstaunlichen Leichtigkeit durch das schmiedeeiserne Bild angedeutet. Im Rathaus von Steinmauern gibt es ein sehenswertes Flößermuseum.
Der „Anker“ ist ein zweites Symbol der Flößerei. Man warf, wie ich schon sagte, Anker in das Ufergebüsch, um ein Floß anzuhalten. Der Sperrriegel konnte ein Floß wohl bremsen, aber die tonnenschwere Last ließ sich damit nicht anhalten. Es gab keine andere Möglichkeit, als Anker zu werfen und so recht abrupt ein Floß anzuhalten. Der Anker wurde das Zeichen für die Floßgaststätten. Überall im Schwarzwald gibt es Gasthäuser, die „Zum Anker“ heißen. Auch das zeigt, wo überall Flößerei betrieben wurde. Gegenüber von Steinmauern liegt an der La Sauer der Flößerort Münchhausen im Elsass. Natürlich kamen auch von den Vogesen Flöße auf der La Sauer, der La Zorn oder der La Lauter herunter.
Das Bild zeigt den „Anker“ von Münchhausen. Strenge Regeln ordneten den Verkehr zwischen Steinmauern und Münchhausen, damit es auf dem Rhein nicht zu Kollisionen kam.
Damit sind wir den weiten Weg von Loßburg die Kinzig herunter bis nach Steinmauern gekommen. Aber ganz in der Nähe von Freudenstadt und Loßburg entspringen auch die anderen großen Schwarzwaldflüsse, die Enz, die Nagold und die Murg, die für die Flößerei so wichtig sind. Kehren wir zurück auf die Schwarzwaldhöhen.
Dort begann 1488 die Flößerei in großem Stil mit der Gründung der Murgschifferschaft.
Die Schiffer, das waren die Holzherren, die Waldbesitzer. Die Flößer waren die Knechte, die Fuhrleute auf den Wasserstraßen.
Die obere Murg ist ein schwieriger Fluss. Zwischen Baiersbronn und Schwarzenberg ist sie ruhig und auf ihr konnten Stämme treiben, aber dann beginnt das wilde Murgtal. Bei Raumünzach wird sie so wild, dass Flößerei unmöglich war. Hier oben am Eingang zum wilden Murgtal lebte der Bruder von Wilhelm Hauff als Pfarrer. Es war eine arme Gegend. Aberglaube war weit verbreitet, denn man lebte ganz abgeschieden im dichten Tann. Die Gestalten, die wir aus den Märchen kennen, waren erlebbar. Wenn die Nebel zogen, dann sah man doch die Geister aus den Bäumen schauen, dann hörte man doch die Tannen sprechen, dann erlebte man doch, wie die Sturmgeister durch den Wald gingen. Daran änderten auch die vielen Wegkreuze nichts. Die Geister waren da und gefährlich. Man verehrte die Geister bis in die Gegenwart. An den zwei Hexentagen im Jahr, am 1.Mai und am 31.10., (Sie verstehen: Allerheiligen und Maiandacht!) wurde der Gasthof Ochsen in Schwarzenberg geschlossen, denn dann tanzten dort die Nymphen und Geister aus Huzenbach. Niemand hätte gewagt, sie zu stören. Ich war in Schwarzenberg und habe nach den Wassergeistern gefragt. Man sagte mir: „Wir haben den Gasthof abgerissen und durch einen modernen Gasthof ersetzt. Wir wollen den ganzen Unfug nicht mehr! Wir haben die Geister in das Museum nach Baiersbronn verbannt!“ Ich verstehe, dass man auch hier modern sein möchte. Ich habe auch die Gelegenheit genutzt in dem großen Gasthof Sackmann zu speisen. Herr Sackmann ist ein berühmter Koch mit vielen Auszeichnungen. Ein genauso berühmter Kollege von ihm arbeitet in Baiersbronn. Man bemüht sich um erstklassige Gastronomie. Aber, ob sich die Geister so ganz einfach in ein Museum vertreiben lassen, da bin ich nach meinen Reisen durch den Schwarzwald nicht ganz so sicher.
Die Murg ließ sich zwischen Raumünzach und Forbach nur durch Trift nutzen. Die Stämme der Tannen mussten durch ein kräftiges Schwallwasser durch das enge, steile Tal getrieben werden, bis sie an der Essel bei Hörden zu geordneten Flößen werden konnten.
Eine sehr große Anlage ist hoch oben im Schwarzwald erhalten geblieben und gibt Zeugnis von den Ausmaßen, welche diese Anlagen auch damals schon haben konnten. Es ist die Herrenwieser Schwallung.
Eine Staumauer sperrt das Tal. Sie ist aus Stein gebaut und ähnelt einer modernen Staumauer.
Sie öffnet sich für die Wasserstube. Hier unterhalb der Staumauer lagen die Stämme, die durch das Tal gebracht werden sollten. Dann wurden die Tore geöffnet, und das Wasser nahm die Tannen mit. Überall am Bachlauf standen Männer mit langen Stangen und hielten die Baumstämme auf Kurs. Das war eine gefährliche und schwere Arbeit. Aber ein Verkeilen der Stämme konnte die ganze Arbeit eines Jahres zu nichte machen. Auch heute sind am wilden Murgtal riesige Stauanlagen, die der Stromgewinnung dienen.
Ähnlich hoch waren sie vielleicht einmal, als noch die große Trift an der Murg üblich war. Die Murgstädte wie Forbach sind sehr stolz auf ihre Flößervergangenheit. Hier ist das Breitbeil, das Handwerkszeug des Holzhauers und Flößers, sogar das Wappen. Mit diesem Beil konnten kunstvoll und schnell Bäume zu Balken geschlagen werden. Mit dem richtigen Handwerkszeug konnten die Holzhauer erstaunlich schnell arbeiten. Auch heute noch gibt es weltweit Wettbewerbe in der Holzhauerei. In Schuttertal bei Lahr finden jährlich große Meisterschaften statt. Kürzlich zeigte Weltmeister Martin Brohammer aus Hornberg auf dem Flößerfest in Schiltach sein großes Können.
Dort wo die Murg ruhiger wird, in Hörden steht auch der Flößer, wie es sich gehört.
In Hörden steht auch das Haus des Holzhändlers Kast. In dem Renaissancehaus ist heute das Flößermuseum untergebracht.
Hörden und Gernsbach, die Familien Kast und Katz, einst Rivalen um die Holzrecht auf der Murg. Heute noch sind die beiden Namen Repräsentanten für große Familien im Tal.
Für die Murgschifferschaft war das ganze Gebiet rund um Baiersbronn frei gegeben, denn so weit im Schwarzwald waren im Mittelalter die Herrschaftsverhältnisse noch nicht geregelt.
Deshalb wurden auch aus dem Enzgebiet und dem Nagoldgebiet Bäume an die Murg gezogen und durch Trift nach Steinmauern geschickt. Der Holzhunger der Holländer war groß und so waren gute Geschäfte möglich.
Das änderte sich als 1501 durch den Markgrafen Christoph I die Pforzheimer Schifferschaft gegründet wurde. Das Enztal war kaum besiedelt. Eine Klostersiedlung hatte man hoch oben im Tal begonnen, Aber wie der Name Enzklösterle sagt, blieb das Kloster klein und arm.
Die klimatischen Bedingungen waren damals anders. Von Oktober bis April oder Mai war der Schwarzwald mit einer dichten Schneedecke zugedeckt. Ackerbau war also nur begrenzt möglich. Die Menschen mussten sich vom Wald ernähren. Die Nutzung der Wälder war ihre einzige Einkommensquelle, und die Arbeit war hart und gefährlich.
Mit dem Ausbau des Enztales kommt ein wenig mehr Wohlstand in das Tal.
Dort liegt ganz versteckt der Poppelsee. Früher war dieser Quell- und Schwallweiher im dichten Tann versteckt und Wilhelm Hauff hörte Geschichten von Feen, Wassermännern und Nymphen, die er in seinen märchenhaften Geschichten einbaute. Hauff lebte im benachbarten Schwarzenberg an der Murg. Dort hatte sein Bruder in einer der ärmsten Gegenden eine Pfarrstelle als evangelischer Pfarrer. Die Wanderungen führten Wilhelm Hauff oft in das Enz. Oben am Poppelsee gab es auch damals schon ein einsames Gasthaus. Als das Gasthaus zur „Sonne“ in Schwarzenberg abgerissen wurde, erwarb das „Cafe´Rosi“ die Bilder und die Möbeln aus Schwarzenberg. Dort steht auch die Bank, auf der Wilhelm Hauff gern in der „Sonne“ in Schwarzenberg saß und seine Geschichten bei einem Glas Wein zu Papier brachte.
Aus der alten Poppelmühle, der obersten Mühle im Tal wurde ein interessantes Erlebnisgasthaus, das bei vielen Ausflügen besucht wird.
Der Poppelsee führt uns ins Enztal mit seiner interessanten Flößergeschichte. Die Enz selber ist ein kleiner Schwarzwaldfluss , und man kann sich kaum vorstellen, welche Berge von Holz über diesen Wasserweg transportiert wurden.
In Wildbad lebte der Fotograf Blumenthal, der noch viele Bilder zur Flößerei geschossen hat, die heute überall in den Museen zu sehen sind.
Diese Bilder zeigen, wie man im ruhigen Wasser in einem Floßhafen die Stämme zusammenband, aber auch wie ein Floß den ganzen Bach ausfüllt und mit Deckladung und Passagieren zu Tal fährt. Der Fußweg durch den Schwarzwald war mühsam und beschwerlich, da war es einfacher mit einem Floß mitzufahren. Der kleine Fluss führt erheblich weniger Wasser als die große Kinzig. Man konnte deshalb keine Kanäle bauen, auf denen die Floße zu Tal fahren konnten. Man war auf „Schwallweiher“ angewiesen.
In der großen Wasserstube am „Christof“ baute man das Floß im Zick-zack.
So konnte das mehrere hundert Meter lange Floß auf dem Holzplatz lagern. Dann wurden die Schwallweiher im oberen Tal, zu denen auch der Poppelsee gehörte abgelassen.
Der Schwall schoss zu Tal von Wasserstube zu Wasserstube, sammelte sich endlich in der großen Wasserstube. Sie wurde „gespannt“, wie man das nannte. Das Floß hob sich mit dem steigenden Wasser. Dann wurde der „Galgen“ das Tor geöffnet und das „Floß“ wurde von dem Wasserstrom mitgerissen. Nun war die ganze Kunst der Flößer am Steuer, an den Floßhaken auf den Gestören und am Bremsriegel gefordert, das Floß genau auf der Welle zu halten. War es zu schnell, überholte es den „Schwall“, dann lag es auf dem Trocknen und verkeilte sich. War es zu langsam, dann verlor es die Welle und lag ebenfalls auf dem Trocknen. Keineswegs jede Floßfahrt gelang! Aber das Wasser war bei einer misslungenen Fahrt verloren und nicht nur die Flößerei brauchte das Wasser, sondern auch die zahlreichen Mühlen im ganzen Tal. Die Kälbermühle am „Christof“ zeigt in einem Bild die Doppelnutzung des Wassers: Auf der einen Seite die Mühle, auf der anderen Seite die Flößerei. Eine Tafel am Wegrand weist auf den weiten Weg hin, den die Baumstämme nun vor sich hatten. Über die Enz wurden sie nach Pforzheim geflößt, dann weiter nach Bietigheim in den Neckar, über den Neckar nach Mannheim, von dort über Köln nach Dordrecht. Dort wurden aus den Tannen Mastbäume für die Segler, die bis nach Asien fuhren, um kostbare Gewürze zu holen. Die Deckladung – oft Eichenstämme – ergab das wertvolle Holz für die Aufbauten der Schiffe.
Der schwimmfähige Rumpf der Segler war aus Tannenholz wie auch die Masten. Aber der Innenausbau ist aus Eichenholz. Interessant ist, dass die Holländer vor allem krumm gewachsene Eichen suchten. Schlägt man die Spannten aus einem anderen Holz, dann sind sie nicht belastungsfähig und brechen. Die Wuchsform des Holzes sollte möglichst der späteren Verwendung entsprechen.
Man kam in den Schwarzwald mit sehr genauen Bestellungen und man kaufte das Holz auf dem Boden liegend. Eine Eiche wurde gefällt, und dann prüften die Holzhändler, was sie gebrauchen konnten. Nur das wurde abtransportiert. Viel Holz blieb so zum Schaden der Waldbesitzer im Wald liegen! Die Aufbauten aber wurden aus Eichenholz gefertigt. Eichenholz ist selber nur sehr begrenzt schwimmfähig. Oft wurden Eichenstämme zwischen zwei Tannenstämmen im Floß eingebunden, um dem Floß keinen zu großen Tiefgang zu geben, denn der Schwall war auch nur höchstens einen Meter hoch. Die Enz führt an Neuenbürg vorbei, einer Flößerstadt, die Wolfach sehr ähnlich sieht. Auch hier begrenzen hohe Mauern den Flusslauf, denn außer den gewollten Schwallwellen musste man auch immer wieder mit verheerenden Hochwassern rechnen.
Der dritte Flusslauf, mit dem wir uns beschäftigen und der ganz andere Flößertechniken erfordert, ist die Nagold. Die Nagold wurde als letzter Fluss zu einem Floßfluss ausgebaut. Die schwierigen Herrschaftsverhältnisse zwischen Baden und Württemberg behinderten die Arbeiten.
Auf dem Bild sieht man die erste Nagoldtalsperre. Sie hat die alten Schwallweiher der Flößerzeit in sich begraben, so dass man sie heute nicht mehr entdecken kann. Die modernen Staumauern sind sicher höher als damals. Aber heute wie damals wird die Wasserkraft der Nagold genutzt. Längst gibt es keine Mühlen mehr an der Nagold, sondern es wird Strom erzeugt, wie an fast allen Schwarzwaldflüssen. Die Übersichtskarte zeigt den gewundenen Ver